|
Die negative Entwicklung, die die IfM-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der zweiten Hälfte 2024 noch beim Umsatz und bei den Investitionen von kleinen und mittleren Unternehmen beobachtet haben, ist in den ersten Monaten 2025 gestoppt worden. Dagegen blieb die Entwicklung bei den Gewinnen negativ.
Abstand zum Europaraum bleibt
Bei den KMU im Euroraum haben sich die Kennziffern Umsatz und Investitionen im ersten Quartal 2025 kaum gegenüber dem Vorquartal geändert. Jedoch sank der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, deren Gewinn gestiegen ist. Da dies auch für die KMU in Deutschland gilt, bleibt der Abstand zwischen den KMU in Deutschland und denen im Euroraum weiter bestehen. In 2024 hatte sich die Lage der KMU im Euroraum besser entwickelt als hierzulande. Das KMU-Barometer des IfM Bonn finden Sie hier.
zurück zum Inhaltsverzeichnis
|
|
In Deutschland wurden in 2024 insgesamt rund 360.000 Existenzen gegründet: Rund 258.000 davon erfolgten im gewerblichen Bereich, 7.040 durch Land- und Forstwirte und 94.900 in den Freien Berufen. Damit entfielen im vergangenen Jahr 71,7 % der Gründungen auf den gewerblichen Bereich, 26,3 % auf die Freien Berufe und 2,0 % auf die Land- und Forstwirtschaft. Damit ist zum ersten Mal seit 10 Jahren der Anteil, der auf den gewerblichen Bereich entfällt, wieder gestiegen.
Die Statistiken "Existenzgründungen insgesamt" und "Existenzgründungen in den Freien Berufen" finden Sie hier.
zurück zum Inhaltsverzeichnis
|
|
Für eine Volkswirtschaft ist nicht nur die Anzahl der Existenzgründungen wichtig, sondern auch deren Fortbestand. Auf Basis der aktuell verfügbaren Daten des Unternehmensregisters beobachten daher die IfM-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler regelmäßig die Überlebensrate von neu gegründeten Unternehmen innerhalb der ersten 5 Jahre: Demnach waren von denjenigen Unternehmen, die 2017 gegründet wurden, nach einem Jahr noch 74 % am Markt aktiv. Mit jedem weiteren Jahr sank die Überlebensrate kontinuierlich.
Zugleich zeigt sich, dass Unternehmen mit Beschäftigten eine etwas größere Überlebenschance besitzen als Solounternehmen: Während nach 5 Jahren von den Gründungen ohne Beschäftigte nur noch gut 34 % bestanden, waren es von denen mit Beschäftigten noch knapp die Hälfte.
Überlebensrate der Unternehmen des Gründungsjahres 2017
![[Grafik konnte nicht geladen werden.]](https://www.ifm-bonn.org/uploads/newsletter/NL202502/NL_2_25_Grafik_3.jpg)
Beständigkeit im Gesundheits- und Sozialwesen am höchsten
Betrachtet man die Wirtschaftszweige, dann waren Gründungen im Gesundheits- und Sozialwesen im Beobachtungszeitraum am beständigsten, gefolgt von Gründungen im Verarbeitenden Gewerbe. Am niedrigsten war die Überlebensrate in der Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsbranche – weniger als ein Drittel dieser Unternehmen überlebte die ersten fünf Jahre.
Überlebensrate von Gründungen nach 5 Jahren (nach Wirtschaftszweigen)
![[Grafik konnte nicht geladen werden.]](https://www.ifm-bonn.org/uploads/newsletter/NL202502/NL_2_25_Grafik_4.jpg)
zurück zum Inhaltsverzeichnis
|
|
Die Gefahr einer Insolvenz hat im vergangenen Jahr in den meisten Wirtschaftszweigen zugenommen, am höchsten war sie im Verkehrs- und Logistikbereich: Hier stellten 14 von 1.000 umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen einen Insolvenzantrag. Im Baugewerbe, im Bereich sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen und im Gastgewerbe waren es 10 von 1.000 Unternehmen. Auch in Wirtschaftszweigen, die vor 5 Jahren kaum insolvenzgefährdet waren, wie beispielsweise das Gesundheits- und Sozialwesen, das Grundstücks- und Wohnungswesen und der Bereich Information/Kommunikation, wurden in 2024 mehr Insolvenzanträge gestellt.
Unternehmensinsolvenzquote (Vergleich 2019/2024)
![[Grafik konnte nicht geladen werden.]](https://www.ifm-bonn.org/uploads/newsletter/NL202502/NL_2_25_Grafik_2.jpg)
Weiterhin deutlich mehr Unternehmensschließungen als Insolvenzen
Dennoch machen weiterhin die Insolvenzen (2024: 21.800) nur einen kleinen Anteil an allen gewerblichen Unternehmensschließungen (2024: 270.000) aus. Zudem enden nicht alle Insolvenzanträge mit der Schließung des betroffenen Unternehmens. So stieg beispielsweise die Anzahl der genehmigten eigenverwalteten Insolvenzverfahren im vergangenen Jahr auf 470. Zum Vergleich: 2023 waren es 345 genehmigte Anträge. Damit hat dieser auf Sanierung ausgerichtete Verfahrensweg seit seiner Einführung vor 25 Jahren einen neuen Höchststand erreicht. Er wird allerdings vorrangig von größeren Unternehmen genutzt. Mehr hierzu finden Sie hier.
zurück zum Inhaltsverzeichnis
|
|

Trotz immer neuer politischer Initiativen, Bürokratie abzubauen, klagen die Führungskräfte seit Jahren über eine steigende Belastung durch immer neue Regularien. In jedem vierten Unternehmen findet autonomer Bürokratieabbau statt, da die Führungskräfte nicht mehr in der Lage sind, alle Vorgaben zu erfüllen. Zugleich geben Unternehmerinnen und Unternehmer an, die Lust an ihrer unternehmerischen Tätigkeit zu verlieren.
In einer ersten Studie im Jahr 2023 betrachteten Dr. Annette Icks und ihr Forschungsteam die Kostenbelastungen für die Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau durch die bürokratischen Vorgaben auf Bundesebene. In einer weiteren Studie haben die IfM-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun die Belastungen untersucht, die den Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau durch die rund 4.000 Vorgaben auf EU-, Bundes-, Bundesland- und kommunaler Ebene entstehen.
NL-Redaktion:
"In Ihrer ersten Studie zu den Bürokratiekosten im Maschinen- und Anlagenbau haben Sie festgestellt, dass die kleinen Unternehmen deutlich mehr unter den Bürokratiekosten leiden als die größeren Unternehmen. Hat sich dies in Ihrer Folgestudie bestätigt?"
Dr. Annette Icks:
"Ja, das hat sich bestätigt: Die Analyse der Bürokratiekosten in unseren Fallbeispielen zeigt, dass die Bürokratiekosten beim kleinsten Unternehmen rund 6,3 % des Jahresumsatzes ausmachen. Bei dem größten von uns untersuchten Unternehmen lagen die Bürokratiekosten hingegen bei rund 1,3 % des Umsatzes."
NL-Redaktion:
"In welchen Unternehmensbereichen fallen Ihrer Analyse zufolge die höchsten Bürokratiekosten an?"
Dr. Annette Icks:
"Wir haben festgestellt, dass die höchsten Bürokratiekosten in den Bereichen Arbeitsschutz, Finanzen/Steuer/Zoll und Personal anfallen. Ursächlich hierfür sind meist einzelne gesetzliche Vorgaben. Um einmal drei konkrete Beispiele zu nennen: Im Arbeitsschutz sind es vor allem Kosten für die Arbeitsmittelsicherheit, im Bereich Finanzen/Steuern/Zoll sind die Vorgaben für die Rechnungserstellung/-archivierung sowie die Aufzeichnung von steuerrelevanten Vorgängen für die höchsten Kosten verantwortlich und im Bereich Personal entstehen die bürokratischen Kosten vor allem durch die Arbeitszeiterfassung."
NL-Redaktion:
"Es liegt also nicht allein an der Anzahl der Vorgaben, die aus einem Ressort kommen,
sondern es spielt auch eine Rolle, wie die einzelnen Vorgaben ausgestaltet sind?"
Dr. Annette Icks:
"Genau. Im untersuchten Zeitraum Mai bis Ende Juli 2024 kamen die meisten Vorgaben zwar aus dem Bundesumweltministerium, die höchsten Bürokratiekosten verursachte aber das Bundesarbeitsministerium."
NL-Redaktion:
"In einer weiteren Untersuchung haben Sie sich die psychologischen Kosten angesehen, die in den Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus durch Ärger und Frust entstehen. Wie hoch ist dieser Anteil an der gesamten Bürokratiebelastung?"
Dr. Annette Icks:
"Von der Mehrheit der Befragten im Maschinen- und Anlagenbau werden die psychologischen Kosten, die mit der Erfüllung der Vorgaben verbunden sind, als mindestens ebenso belastend – wenn nicht sogar als belastender – angesehen. Dabei führen Wut und Ärger, aber auch das Gefühl des 'Allein-Gelassen-Seins' mindestens zu einer dauerhaften Belastung. Im schlechtesten Fall hemmt es das Wachstum der Unternehmen."
NL-Redaktion:
"Wie kann der Bürokratiebelastung nach Ansicht Ihrer Befragten effektiv entgegengewirkt werden?"
Dr. Annette Icks:
"Die von uns befragten Führungskräfte wünschen sich von der Politik vor allem mehr Vertrauen. Daneben halten sie es für wichtig, dass die unternehmerische Expertise stärker einbezogen wird, um eine größere Verständlichkeit sowie eine möglichst maßvolle Umsetzung von Verordnungen zu erreichen. Auch sollten die Regularien – nicht zuletzt aufgrund des raschen technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels – stärker auf die Realität abgestimmt werden."
Die Studie "Bürokratiekosten von Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau – Folgestudie 2025", die das IfM Bonn im Auftrag der Impuls-Stiftung erstellt hat, finden Sie auf der Internetseite des IfM Bonn hier, das Chartbook "Der Umgang von Unternehmen im Anlagen- und Maschinenbau mit Bürokratie" hier.
zurück zum Inhaltsverzeichnis
|
|
Die häufig langen gewerblichen Baugenehmigungsverfahren entwickeln sich zunehmend zu einem volkswirtschaftlichen Standortnachteil für Deutschland. Mittelfristig sollte daher laut IfM-Studie "Politikansätze zur Beschleunigung und Vereinfachung von gewerblichen Baugenehmigungsverfahren" das Baurecht vereinfacht und transparenter gestaltet werden. Unabhängig davon empfehlen die IfM-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Entscheidungsträgern, in den kommunalen Behörden, eine "Ermöglichungskultur" zu etablieren. So könne eine serviceorientiertere Herangehensweise mittelfristig zu einer florierenden lokalen Wirtschaft und steigenden Gewerbesteuereinnahmen beitragen.
Digitale Bauakten tragen zu schnelleren Verfahren bei
Um die Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen, bedarf es auch digitaler Lösungen. Schon heute erweisen sich beispielsweise digitale Bauakten als hilfreich, da sie lange Postlaufzeiten vermeiden, den Verfahrensstand transparent machen und allen Beteiligten eine gleichzeitige Bearbeitung ermöglichen.
zurück zum Inhaltsverzeichnis
|
|
Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, die Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI) nutzen, ist zwischen 2023 und 2024 um 8 Prozentpunkte auf 19 % gestiegen. Damit liegt der Anteil der KMU in Deutschland mit KI-Nutzung zwar über dem EU-Durchschnitt, aber weiterhin unter dem Anteil vergleichbarer Unternehmen in Dänemark (26 %), Schweden (24 %) oder Belgien (23 %).
Die KI-Nutzung in den Großunternehmen in Deutschland hat stärker zugenommen (+ 13 Prozentpunkte) als in den KMU, wodurch sich die Schere zwischen den KMU und den Großunternehmen weiter öffnet.
Unternehmen mit KI-Nutzung im EU-Vergleich
![[Grafik konnte nicht geladen werden.]](https://www.ifm-bonn.org/uploads/newsletter/NL202502/NL_2_25_Grafik_1.jpg)
zurück zum Inhaltsverzeichnis
|
 |
Unzufriedenheit mit den Standortbedingungen, rezessive Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe, Ankündigung von US-Zöllen – die deutsche Wirtschaft befindet sich aktuell in einer schwierigen Lage. Im Podcast "Auf dem Weg zu mehr Wettbewerbsfähigkeit" beleuchten renommierte Vertreterinnen und Vertreter aus der Wissenschaft und der Wirtschaft, wie die aktuelle Situation verbessert werden kann.
Der Podcast ist sowohl auf der Internetseite des IfM Bonn als auch im YouTube-Kanal
"Der Mittelstand – kurz und knapp" des IfM Bonn und auf Spotify zu finden.
|
|
 |
|
Roundtable Mittelstand fordert von der Politik strategischen Weitblick statt reaktiver Ad hoc-Maßnahmen
"Die überwiegende Mehrheit der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer im Mittelstand wünscht sich laut einer Kurzbefragung von der neuen Bundesregierung gute und zuverlässige Rahmenbedingungen – und weniger lenkende Vorgaben. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die ökologische Transformation. Gleichwohl wird deren Notwendigkeit prinzipiell nicht in Frage gestellt", mit diesen Worten eröffnete Prof. Dr. Dr. h.c. Friederike Welter Ende März den jährlich stattfindenden Roundtable Mittelstand in Berlin. Rund 30 Vertreterinnen und Vertreter von wissenschaftlichen Instituten, Wirtschaftsverbänden, von der KfW Bankengruppe sowie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen diskutierten diesmal über die Frage, was der Mittelstand von der nächsten Bundesregierung erwartet. Die Antworten hierzu finden Sie hier.
Boys‘ Day am IfM Bonn
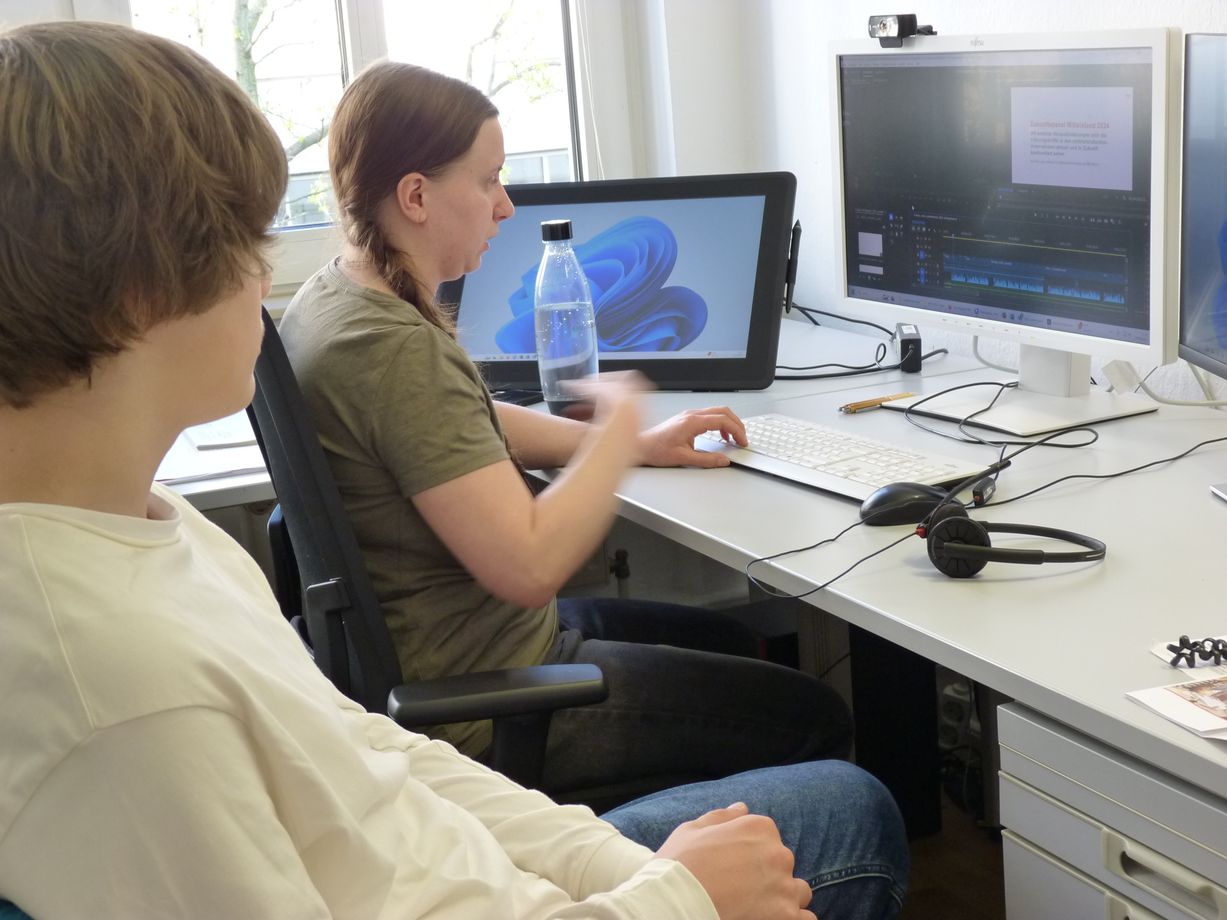
Welche Tätigkeiten gibt es in einem wissenschaftlichen Institut? Wie arbeiten die verschiedenen Bereiche zusammen? Welche Voraussetzungen muss man für die verschiedenen Berufe mitbringen? Antworten auf diese Fragen erhielt der 14jährige Schüler Gabriel Anfang April beim diesjährigen Boys‘ Day im Institut für Mittelstandsforschung Bonn.
Policy Brief: Neue Veröffentlichung
In Nordrhein-Westfalen nutzt bisher rund ein Drittel der Handwerksbetriebe Künstliche Intelligenz. Vorrangig kommen dabei Anwendungen wie Chatbots, Sprachassistenten, Übersetzungssoftware oder Bild- und Videobearbeitung zum Einsatz. Im Policy Brief "Künstliche Intelligenz im Handwerk" zeigt Prof. Dr. Klaus Schafmeister (Fachhochschule des Mittelstands/Bielefeld) anhand der Ergebnisse einer Befragung unter mehr als 800 Handwerksbetrieben auf, mit welchen Herausforderungen die Unternehmen zu kämpfen haben – und was die Politik zur KI-Verbreitung im Handwerk beitragen kann.
 |
|
Status Quo in der Entrepreneurship Education
Seit vielen Jahren wird ökonomische Bildung in den Schulen gefordert. Wie aber ist der aktuelle Status Quo im Hinblick auf die Förderung unternehmerischen Denkens und Handelns? Dieser Frage geht der Sammelband "Entrepreneurship Education II", herausgegeben von Brigitte Halbfas (Bergische Universität Wuppertal), Ilona Ebbers (Europa-Universität Flensburg) und Dr. Teita Bijedić-Krumm, nach.
Widerstandsfähigkeit von verschuldeten Unternehmen gegenüber Hochwasserereignissen
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Höhe und Fälligkeit von Verbindlichkeiten und der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit der europäischen KMU in Europa? Diese Frage untersuchen Dr. Vinzenz Peters und Flavio de Carolis (Maastricht University) in ihrem Workingpaper "European SMEs, Corporate Finance and Economic Resilience to Floods".
Wie der Wasserknappheit in Deutschland entgegengewirkt werden kann
Im Beitrag "Herausforderungen in der Wasserwirtschaft bedürfen innovative Lösungen" zeigt ein Autorenteam, dem unter anderem Prof. Dr. Dr. h.c. Friederike Welter, Dr. Siegrun Brink und Dr. Markus Rieger-Fels angehören, verschiedene zukunftsweisende Maßnahmen zum Umgang mit der Wasserknappheit auf. So könnte beispielsweise mit dem frühzeitigen Einsatz von Reallaboren die Praktikabilität neuer Technologien getestet und deren Nutzung in der Wasserwirtschaft erhöht werden.
Entrepreneurshipforschung im Zeichen multipler Krisen
Seit mehreren Jahren werden die Unternehmerinnen und Unternehmer durch stetig neue
krisenhafte Situationen herausgefordert. Dies wirkt sich auch auf die Entrepreneurshipforschung
aus. In ihrem Beitrag "Rooting so We Can Flow: Weaving the Fabric of Transformational Scholarship in Entrepreneurship" legt Prof. Dr. Dr. h.c. Friederike Welter gemeinsam mit weiteren internationalen Entrepreneurshipforscherinnen und -forschern dar, wie sich Forschungspraktiken verändern und warum es wichtig ist, sich umfassend zu vernetzen und auszutauschen.
|
 |
|
Beim Kommunalpolitischen Ausschuss von Handwerk.NRW stellte Michael Holz Mitte April dar, wie die Politik den bürokratischen Belastungen im Mittelstand entgegenwirken könnte. Dabei verwies er auch auf positive Ansätze in den Niederlanden und in Großbritannien.
Auf der Packaging Machinery Conference Anfang Juni in München präsentierte Dr. Annette Icks die vielfältigen Studienergebnisse des IfM Bonn zum Thema "Bürokratieabbau".
Peter Kranzusch stellte auf dem Bund-Länder-Ausschuss Mittelstand Ende April in Chemnitz das Gründungs- und Liquidationsgeschehen 2024 vor dem Hintergrund zunehmender politischer Verunsicherung vor. Auf derselben Veranstaltung
gab Dr. Susanne Schlepphorst erste Einblicke in die aktuelle Befragung des IfM Bonn zum Mutterschutz für Selbstständige im Handwerk.
Wohin entwickelt sich die Baubranche? Wann kommt wieder ein Aufschwung? Antworten
auf diese Fragen gab Anfang April Dr. Nadine Schlömer-Laufen im Rahmen einer Diskussionsrunde auf dem Immobilentag 2025 in Neuss.
Kinder von selbstständigen Eltern sind später häufig auch selbst selbstständig tätig. Dies zeigte Dr. Stefan Schneck in seinem Vortrag auf der EBES Conference in Rom Mitte April auf.
An der South East Technological University in Waterford (Irland) referierte Prof. Dr. Dr. h.c. Friederike Welter Anfang Juni über das Thema "Re-Thinking Entrepreneurial Places". Mitte März stellte sie auf der Vollversammlung der IHK Bonn/Rhein-Sieg dar, wie Bürokratie effizient reduziert werden könnte.
zurück zum Inhaltsverzeichnis
|
|
|